Die Qual der Erinnerung
Depressionen, Schlafstörungen, Angst - für sie alle gehört das zum täglichen Leben. Auch den Lüneburger Hauptfeldwebel Uwe Heiland hat der Krieg verändert.
Seit 2008 wird der 41-Jährige die Bilder aus Afghanistan, dem Kosovo und Sumatra nicht mehr los. Und trotzdem würde er am liebsten noch einmal in den Auslandseinsatz gehen.
Ein Spaziergang durch die Stadt - gemeinsam mit seinen Hunde Saphira und Bruno ist das für Uwe Heiland heute wieder möglich. Doch lange Zeit mied der 41-Jährige die Öffentlichkeit.
„Ich bin mit Vorfreude gegangen“
Als Uwe Heiland 1997 zum Wehrdienst einberufen wird, hat er bereits eine Ausbildung zum Krankenpfleger abgeschlossen. So liegt es nahe, den jungen Soldaten während seiner dreimonatigen Grundausbildung in Horb am Neckar auch in die Arbeit des Sanitäters und Rettungsassistenten einzuweisen. „Das machte mir Spaß und ich habe mehr Geld verdient als draußen, in dem Beruf, den ich gelernt habe“, sagt er. Uwe Heiland entscheidet zu sich zu bleiben– zunächst für vier Jahre.
In den Auslandseinsatz zu gehen, steht Mitte der 90er Jahre noch nicht zur Debatte. „Das gab es damals noch gar nicht so, es war keine Rede davon, dass ich irgendwann ins Ausland muss“, erinnert sich Heiland.
Ein paar Jahre später hat sich die Lage geändert: Nach dem Kosovo-Krieg schickt die NATO ab 1999 Soldaten aus 30 Nationen in das Land. Unter ihnen ist 2001 auch Uwe Heiland. „Ich bin mit einer Vorfreude gegangen, man könnte es spannend beschreiben, mit Vorfreude auf das, was mich dort erwartet.“
In den Lazaretten dieser Welt
Vier weitere Male fliegt Uwe Heiland ins Ausland, um zu helfen. 2003 geht es für den Soldaten fünf Monate lang nach Kabul, Afghanistan, 2005 folgt ein Einsatz im Rahmen der Tsunamihilfe in Banda Aceh, Sumatra. Noch im gleichen Jahr schickt man ihn erneut nach Afghanistan, diesmal in die Region Kunduz und 2007 nach Sarajevo in Bosnien und Herzegowina.
Wieder und wieder macht sich Heiland auf den Weg, wieder und wieder versorgt er verletzte Kameraden und Zivilisten, ist umgeben von zerstörten Häusern und Städten, sieht Leichen.
„Die ersten paar Male hatte ich keine Angst und mir keine Gedanken über die Gefahren gemacht, was auf mich zukommen könnte. Das war auch nie das Thema, das wusste ich einfach nicht.“
Die Angst und die Erinnerungen holen ihn erst Jahre später ein.
Das Gefühl der Todesangst
11. September 2003: Raketenangriff auf das Bundeswehrlager in Kabul. Uwe Heiland flüchtet mit seinen Kameraden in einen Schutzbunker. Er hat Angst, das erste Mal echte Todesangst. Es ist eines von drei Erlebnissen, die den Soldaten prägen.
Wenn die Angst das Leben bestimmt
Heiland zieht sich zurück, will nicht mehr reden, bekommt Depressionen. In fremden Menschen sieht er eine Gefahr, ganz besonders wenn es Ausländer sind. Geschlossene Räume lösen Angst in ihm aus, nie wieder lässt Heiland zu, dass sich jemand hinter ihm aufhält.
Ein Spaziergang durch die Stadt, ein Besuch im Restaurant, ein ganz normales Leben – das ist für den Soldaten, der immer Stärke und Mut zeigte, plötzlich nicht mehr möglich. Er will vor den Erinnerungen fliehen und versucht sich das Leben zu nehmen.
Aus dem Krieg in den Alltag
Auch für Uwe Heilands Ehefrau und die zwei Töchter waren die Folgen des Krieges allgegenwärtig. Der Papa, der Ehemann, der Freund – er war nicht mehr wiederzuerkennen und nicht mehr zu verstehen. „Was überhaupt nicht läuft ist die Versorgung der Angehörigen, der Kinder und Ehefrauen“, sagt Uwe Heiland über die Hilfsangebote seitens der Bundeswehr. Therapieprogramme für Paare und Familien habe er sich gewünscht, „aber zu meiner Zeit gab es da gar nichts“.
Heute leben Uwe Heiland und seine Ehefrau in Trennung, „aber wir verstehen uns noch gut“. Rund 600 Kilometer wohnen der Vater in Niedersachsen und die Kinder in Rheinland-Pfalz auseinander. Ein bis zwei Mal im Monat besuchen sie sich.
Freunde von damals hat Uwe Heiland keine mehr. „Die haben sich alle abgewandt, weil ich ja wirklich nicht mehr ganz normal war.“
"So geht es nicht weiter"
Ein Leben in Angst will er nicht mehr führen. Er entschließt sich Hilfe zu holen und meldet sich im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz. „Es war eine Überwindung. Ich glaube keiner geht gerne in eine Psychiatrie, das alleine hat schon Überwindung gekostet“, sagt Heiland.
Der Soldat schildert seine Situation und wird wenige Wochen später stationär aufgenommen. Es folgen Gespräche, Therapiegruppen, Übungen zur Traumabewältigung.
Dann die Diagnose: Posttraumatische Belastungsstörung.
„Ich war ehrlich gesagt froh darüber, dass ich eine Diagnose hatte. Jetzt konnte man dem Ganzen einen Namen geben. Ich war nicht davon ausgegangen, dass ich PTBS habe.“
Im Telefoninterview erklärt Dr. Roger Braas, wie PTBS entsteht und welche Folgen sie für Betroffene und Angehörige haben kann.
Verletzungen der Seele
Flottenarzt Dr. Roger Braas, Leiter der psychiatrischen Abteilung des Bundeswehrkrankenhauses in Koblenz, ist Spezialist in der PTBS-Therapie.
"Eine psychische Narbe bei einer einmal erlittenen PTBS bleibt", sagt er. Doch eine zielgerichtete Therapie könne den Betroffenen helfen, damit besser umzugehen und den Alltag wieder zu meistern.
"Wenn ich sie nicht hätte, wäre ich heute nicht mehr da"
Erst war sie nur eine Maßnahme zur
Traumabewältigung, dann wurde Leonberger-Hündin Saphira zu Uwe
Heilands bestem Freund. Die Therapiehündin zeigte ihm den
Weg aus der Depression -
zurück ins Leben.
Einmal Soldat - immer Soldat
Er sei gern Soldat und würde sich auch immer wieder für den Beruf entscheiden, sagt er. Alle Versuche sich noch einmal in das zivile Berufsleben einzuordnen scheiterten, „gingen gar nicht“. Er habe sich nicht mehr unterordnen können, fühlte sich wie ein Lehrling, bekam „keinen Fuß mehr auf den Boden“, sagt Uwe Heiland heute.
Erst seit Kurzem ist er Berufssoldat, erst seit Kurzem lebt und arbeitet er in Norddeutschland. Eine anerkannte Wehrdienstbestätigung und die Bescheinigung über eine geminderte Erwerbsfähigkeit durch den Kriegseinsatz von mindestens 30 Prozent waren die formalen Voraussetzungen für eine Anstellung. So steht es im „Einsatzversorgungs-Verbesserungsgesetz“ und so funktionierte es für Uwe Heiland.
Als Sanitäter kann und darf er nicht mehr arbeiten. Statt Brüchen, Schnitt- und Schussverletzungen versucht Uwe Heiland nun die seelischen Wunden zu heilen, die ein Krieg reißen kann. In der Lüneburger Kaserne kümmert er sich um die Angehörigen der Soldaten, die im Auslandseinsatz sind. Als Lotse für Einsatzgeschädigte ist er Ansprechpartner für traumatisierte Soldaten: „Ich habe es mir bewusst ausgesucht, dass ich in diese Richtung gehe, weil ich mit den Auslandseinsätzen nicht abschließen möchte. Wenn Kameraden krank aus den Einsätzen zurück kommen, möchte ich helfen, nicht, dass sie die Erfahrung machen müssen, die ich erlebt habe.“
Das Erlebte, die Erinnerung, die Angst – heute beeinträchtige das Uwe Heiland kaum noch. Mit seinem Leben sei er voll zufrieden, sagt er. Von der Bundeswehr wurde er als gesund eingestuft. Damit könnten wieder neue Auslandseinsätze auf den Lüneburger Soldaten zukommen. „Ich kann mir durchaus vorstellen nochmal in den Auslandseinsatz zu gehen“, sagt er. Eine Zeit lang sei ihm das sogar ein großes Bedürfnis gewesen, wie fast allen, die unter PTBS leiden. „Wahrscheinlich aus dem Grund, dass man dort irgendetwas noch nicht fertig gemacht hat. Man hat vielleicht ein Stück von sich selbst dort gelassen, man ist auf Suche, es wieder zu finden“.
Uwe Heiland ist pflichtbewusst. Sich für einen Beruf zu entscheiden und ihn nicht in voller Gänze zu erfüllen, das kommt für den Hauptfeldwebel nicht in Frage. „Wenn der Dienstherr mich irgendwo hin schickt, ist es meine Pflicht dorthin zu gehen, sonst hätte ich nicht Soldat werden dürfen. Wir sind eine Einsatzarmee und dann frage ich nicht groß nach“.
Hilfe für Betroffene
PTBS-Hilfeseite
Unter http://www.ptbs-hilfe.de/ bietet der Sanitätsdienst der Bundeswehr weitere Informationen und einen Online-Selbsttest zur PTBS an.
Telefon-Hotline
PTBS-Betroffene können sich jederzeit und anonym unter der Telefonnummer 0800 588 7957 Rat holen.
Kontaktformular
Über ein E-Mail-Kontaktformular können Sie Fragen und Nachrichten an das Zentrum für Psychiatrie und Psychotraumatologie am Bundeswehrkrankenhaus in Berlin senden.
Credits
Unterstützt von der Sparkassenstiftung Lüneburg.
Redaktion und Gestaltung
Anke Dankers
Text und Recherche
Anke Dankers
Fotos
Ina Schoenenburg, Katja Grundmann
Videos
Anke Dankers, Katja Grundmann












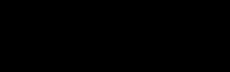











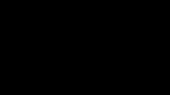
 Die Qual der Erinnerung
Die Qual der Erinnerung

 „Ich bin mit Vorfreude gegangen“
„Ich bin mit Vorfreude gegangen“
 In den Lazaretten dieser Welt
In den Lazaretten dieser Welt
 Das Gefühl der Todesangst
Das Gefühl der Todesangst
 Wenn die Angst das Leben bestimmt
Wenn die Angst das Leben bestimmt
 Aus dem Krieg in den Alltag
Aus dem Krieg in den Alltag
 "So geht es nicht weiter"
"So geht es nicht weiter"
 Verletzungen der Seele
Verletzungen der Seele
 "Wenn ich sie nicht hätte, wäre ich heute nicht mehr da"
"Wenn ich sie nicht hätte, wäre ich heute nicht mehr da"
 Einmal Soldat - immer Soldat
Einmal Soldat - immer Soldat
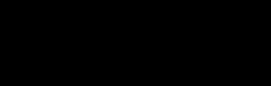 Hilfe für Betroffene
Hilfe für Betroffene